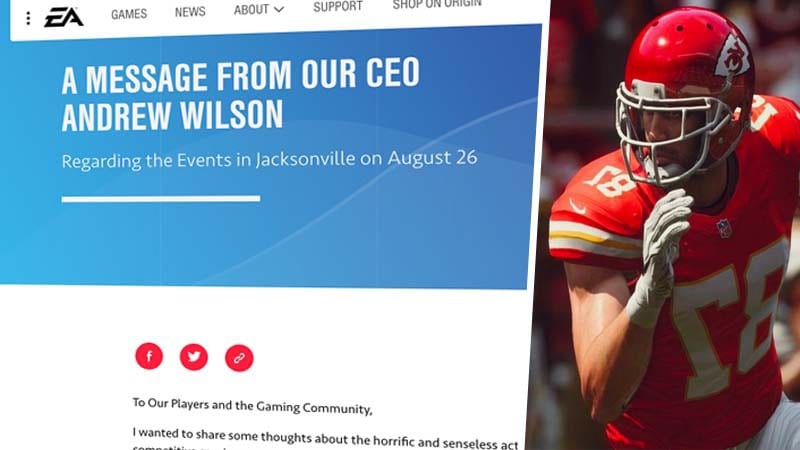Killerspiele: Ein Wort, das die Emotionen hochkochen lässt und seit Jahren durch die Medien geistert. Die Fronten sind verhärtet, eine Diskussion scheint unmöglich. In unserer Kolumne überlegen wir nicht nur, warum das so ist, sondern auch, woher die voraussehbaren Schuldzuweisungen kommen und was wir alle tun können, damit der Konflikt nicht noch länger ungelöst und undiskutiert vor sich hinköchelt.
Und täglich grüßt das Murmeltier: Sie sind zurück, die bösen, gefräßigen Killerspiele und erneut haben sie zugeschlagen und ihre Klauen in sonst so unbefleckte Menschen geschlagen. „Nein!", schreit der Pöbel auf der anderen Seite des imaginären Zauns und zetert hysterisch, unsachlich und – ohne es zu bemerken – selbstironisch über fehlende Stichhaltigkeit der Unterstellung, der Konsum von Videospielen könne aggressiv machen.
Man verzeihe uns an dieser Stelle die überspitzte und etwas flapsige Darstellung beider Parteien, aber wir sind es einfach leid. Denn dieses Spiel spielen wir schon viel zu lange und der Plot ist noch repetitiver als die Nebenmissionen der Assassin's Creed-Reihe: Nach einer (oft medial sehr ausgeschlachteten) Gräueltat wird bekannt, dass der Täter regelmäßig sogenannte Killerspiele konsumierte oder diese auch nur besaß und schon entfacht die Diskussion, die gefühlt schon so alt wie Videospiele selbst ist, erneut: Während die eine Seite das virtuelle Töten für tatsächlich begangene Morde verantwortlich macht, tut die andere Seite jeglichen gravierenden Einfluss von virtuellen Medien auf die Realität als lächerlich ab und begibt sich in eine kategorische Abwehrhaltung.
Eine Diskussion entsteht nicht, stattdessen tänzeln beide Seiten umeinander herum, schmeißen sich einzelne Wortbrocken, Argumente und Inkompetenzvorwürfe zu und weisen jede Schuld an der wenig zielführenden Gesprächskultur heftig von sich. Auch wir können diesen Konflikt nicht lösen, aber wir wollen uns heute doch mit dem großen Warum beschäftigen. Warum die voraussehbaren Schuldzuweisungen, wann immer etwas Schlimmes passiert? Warum Videospiele? Warum die kategorische Abwehrhaltung auf Gamer-Seite? Und warum ändert sich nichts, obwohl das Thema doch seit Jahren immer und immer wieder aufkommt?


Ein Killerspiel – Was ist das eigentlich?
Killerspiele: Wir alle kennen den Begriff und bekommen fast automatisch imaginäre Wutpickel, wenn er auftaucht. Das Wort zu hören macht Gamer heutzutage vermutlich aggressiver als ein 24 Stunden-Marathon des blutrünstigen Spiels, das zu finden ist. Entschuldigung, da war er wieder, der etwas flapsige Humor, aber mal ganz ehrlich: Wir nehmen das Thema sowieso schon viel zu persönlich, etwas Abstand und Selbstironie würde der derzeitigen Stimmung sicherlich nicht schaden.
Also: Was ist das denn nun, ein Killerspiel? Eine klare und einheitliche Definition gibt es derzeit – trotz ständiger Präsenz – nicht. Prinzipiell soll der Begriff aber Titel kategorisieren, in denen der Spieler eine Figur steuert, die vermehrt, grausam und meist detailreich zu beobachten menschliche (oder menschlich aussehende) Charaktere tötet. Gerade erhitzten Gemütern reicht allerdings auch oft der Fakt, dass der Spieler mit seinem Charakter tötet, Punkt. An unsere eigene Steam-Bibliothek denkend, dürften auch wir in Bedrängnis geraten, zumindest wenn wir den Gedanken mal auf die Spitze treiben:
Während wir in The Binding of Isaac (mehr oder weniger) hilflosen Kreaturen mit unseren Körperflüssigkeiten das Leben aushauchen und das Blut nur so spritzt, können wir auch durch (unterlassene) Handlungen in Spielen wie The Walking Dead oder Life is Strange töten. In The Last of Us eliminieren wir nicht nur menschenähnliche, sondern auch tatsächliche Menschen und wie vielen Lebewesen wir in der Assassin's Creed-Reihe ein möglichst schnelles Ende beschert haben, möchten wir lieber nicht wissen. Ganz abseits von den klassischen Shootern, können – mit genug Willen und Kreativität – also auch bisher unbehelligte Titel ins Fadenkreuz geraten. Prinzipiell fallen aber primär die Spiele, bei denen das Töten den Hauptteil der Spielzeit ausmacht, dem negativ konnotierten Begriff zum Opfer. Da aber eine klare Definition fehlt, ist dieser äußerst dehnbar, was immer wieder zu beobachten ist, wenn Medien und besorgte Bürger nach einem grausamen Geschehnis in der Realität nach einer Ursache und einem handfesten Grund suchen. Mit genug Angst und Wut im Bauch kann fast jeder Titel als Killerspiel klassifiziert werden, so scheint es fast.


Auf der Suche nach dem unsichtbaren Feind
Aufgebrachte Gamer unterstellen der Gegenseite gerne Arroganz und mangelndes Fachwissen, wenn diese entsprechende Videospiele kritisieren. Während Letzteres sicherlich stimmt und die wenigsten sich gut mit den Spielen auskennen, die sie dort angehen, geschweige denn zusätzlich über ein entsprechendes psychologisches Hintergrundwissen verfügen, ist es wenig zielführend, grundlegend erst einmal aus Prinzip niedere Motive zu unterstellen. Die (zumeist wenig inhaltvolle) Diskussion hält sich nicht hartnäckiger als ein Pickel vor dem ersten Date, weil die Menschen etwas gegen Gamer per se haben, sondern weil sie Angst haben. Immer wieder erschüttern Amokläufe die Menschheit und die Bilder von verletzten und panischen Erwachsenen, aber immer wieder auch Jugendlichen und Kindern brennen sich durch die ausführliche Berichterstattungen in unsere Gedächtnisse ein. Die Todeszahlen allein erschrecken uns, aber es sind die Bilder, die Berichte von Augenzeugen und die vor die Kamera gezerrten Angehörigen, die eine sehr menschliche und tiefgreifende Angst in uns wecken: die Angst, dass eines Tages auch wir betroffen sein könnten oder jemand, den wir lieben.
Wer selbst einmal einen Verlust erlebt hat, kennt den Schmerz, das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit und oft auch die Wut. Diese ist eine der Phasen der Trauer und aktiviert, gibt Kraft weiterzumachen und mit einem Teil unserer überwältigenden Emotionen umzugehen. Ist beispielsweise durch einen Unfall ein klarer Gegner auszumachen, konzentriert sich die Wut – kurz- oder langfristig – in der Regel auf diesen. Der Fokus liegt hier auf der pochenden Mischung aus Schmerz und Vorwürfen, die sich nun als aktive Kraft gegen ein gezieltes Objekt richten kann, denn Wut ist leichter auszuhalten als Hilflosigkeit und Leere oder die Frage, ob man selbst etwas hätte tun können. Kurzfristig hilft es, einen Übeltäter zu haben, einen Feind, dem man die volle Verantwortung übertragen kann. Ist der Gegner nicht klar auszumachen, beispielsweise weil es sich um eine Krankheit handelt, richtet sich die Wut gegen Gott und die Welt, die erwünschte Erleichterung bleibt aber in der Regel aus. Kurz: Einen greifbaren Gegner zu haben, jemanden, den man als Schuldigen identifizieren kann, hilft. Denn dieser kann bekämpft werden und es können Maßnahmen ergriffen werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern… oder zumindest die Illusion von zukünftiger Sicherheit aufrechtzuerhalten.
Wenn Antworten ausbleiben
Da wir nicht in die Köpfe der Täter gucken können, werden wir ihre Beweggründe aber nie vollständig nachvollziehen können. Gerade Amokläufer neigen dazu sich nach Ende ihrer Tat selbst zu töten, werden sie nicht vorher bereits von der Polizei erschossen. Was tun also, um die drängende Frage nach dem Warum zu klären? Es bleiben nur physische Beweise wie hinterlassene Abschiedsbriefe und Gegenstände. Sieht man Todeslisten oder geschriebene Worte voller Hass, wird nur klar, dass ein Plan dahintersteckte. Aber das Kapitel bleibt offen, die Frage nach dem Warum ungeklärt. Selbst vom Täter hinterlassene Erläuterungen wirken unbefriedigend. Da muss doch mehr, ein Sinn dahinterstecken, die Tragödie muss doch irgendwie begründbar sein, sei es nun durch Religion, Herkunft oder irgendeine Eigenschaft, die nur eine Minderheit der jeweiligen Gesellschaft zeigt! Und wenn nicht, woher wissen wir dann, dass Ereignisse dieser Art sich nicht wiederholen, dass nicht unser Nachbar gefährlich sein könnte oder unser neuerdings so schlecht gelaunter Angestellter? Wie können wir unsere Partner und Kinder noch mit sicherem Gefühl aus dem Haus lassen, wenn es keine Erklärung gibt?
Das Bedürfnis nach Sicherheit ist eines der grundlegendsten eines jeden Menschen. Dinge, die sich komplett außerhalb unserer Kontrolle befinden oder die wir nicht verstehen, beängstigen uns. Um uns halbwegs sicher zu fühlen, brauchen wir eine Erklärung, einen sichtbaren Gegner, den wir bekämpfen können. Und wenn wir dann brutale Spiele sehen, in denen möglichst viele Menschen zu töten das Ziel ist, scheint die erste Schlussfolgerung, dass hier ein Zusammenhang besteht, erst einmal logisch. Obwohl wir selbst wissen, dass Mobbing, Gewalterfahrungen in Kindheit und Jugend, wenig Halt im Familien- oder Freundeskreis und psychische Erkrankungen als Ursache sehr viel realistischer klingen, sind all das Faktoren, auf die wir als Einzelpersonen akut erst einmal keinerlei Einfluss haben. Und vor allem: Wenn die Spiele die Schuld tragen, müssen wir diese nicht in unserer Gesellschaft oder gar bei uns persönlich suchen.


Verhärtete Fronten
Dass kein psychisch gesunder, sozial integrierter und stabiler Mensch einfach so durch – egal wie grausame – Videospiele auf die Idee kommt, andere Menschen wirklich zu töten, sollte jedem nicht gerade vor Emotionen erblindeten Menschen klar sein. Dass interaktive Medien gerade aufgrund der Modellwirkung und besonders auf junge, noch weniger gefestigte Persönlichkeiten einen Einfluss haben, ist allerdings ebenso wenig zu leugnen. Ein übermäßiger Konsum von gewaltlastigen Szenen (egal ob im Internet, in der Zeitung, im Fernsehen oder in Videospielen), führt bewiesenermaßen dazu, dass bei entsprechenden Bildern deutlich geringere physiologische Reaktionen gezeigt werden und eine körperliche Abstumpfung stattfindet. Eine Kausalrelation zwischen dem Konsum entsprechender Games und dem langfristigen Zeigen von Gewalt, geschweige denn des Begehens von Amokläufen konnte dagegen nicht nachgewiesen werden.
Hier ist der Punkt: Menschen sind definitiv beeinflussbar, das hat nicht nur unsere Geschichte, sondern haben auch Forscher wie Milgram, der die Bereitschaft von Menschen, einer Person scheinbar bis zu tödliche Stromschläge zu verpassen, wenn sie eine Autorität dazu aufforderte, nachwies, und Zimbardo in seinem Stanford-Prison-Experiment, das den Einfluss von verschiedenen Machtpositionen während eines simulierten Gefängnisaufenthalts aufdeckte, gezeigt. Auch dass in einem Film zu zeigen, wie jemand für aggressives Verhalten belohnt wird, zumindest kurzfristig einen Einfluss auf Kinder hatte und diese zum Nachahmen animierte, konnte Albert Bandura im Rahmen seiner Studien zum Modelllernen bereits eindrucksvoll belegen.
Auch genetische Dispositionen und das soziale Umfeld sind nicht zu unterschätzen, vor allem die elterliche Erziehung und mit steigendem Alter auch die Gruppe der Gleichaltrigen haben einen enormen Einfluss auf die Entwicklung eines Menschen. Wer behauptet, allein der übermäßige Konsum von Medien könne Menschen wie fremdgesteuert zu roboterartigen Killern machen, mit dem ist keine Diskussion möglich, weil ihm hierfür dringend notwendige kognitive Grundlagen wie eine entsprechende Reflexionsfähigkeit fehlen. Aber das tun die wenigsten und trotzdem zeigen sich kaum Gamer zur Diskussion bereit, fordern diese allerdings paradoxerweise gleichzeitig auch vehement ein.
Liebe Gamer: Meinungen ändern sich nicht von allein
Liebe Gamer, Teammates, verhasste Lieblingsgegner: Wenn sich jemand besorgt über gewaltverherrlichende Spiele äußert, dann macht doch nicht sofort zu. Argumentiert mit der Altersfreigabe, die bestimmte Spiele für Kinder und Jugendliche erst gar nicht zugänglich machen sollte (oft dann aber beispielsweise durch Eltern oder ältere Freunde umgangen wird), sprecht über verschiedene Bestandteile des Spielens wie Strategieumsetzung und Teambuilding, über Freundschaften, die entstehen. Erklärt, dass auch das Zocken eine Möglichkeit ist sich abzureagieren, sprecht über den kompetitiven Charakter von Shootern, bei dem der Reiz möglichst viele Menschen zu töten in der Anzahl, der Fehlerquote oder der Schnelligkeit liegt, in dem Übertreffen anderer, nicht in dem Töten an sich.
Zeigt auf, wie sich das Bild, das euer Diskussionspartner von entsprechenden Spielern hat, so gar nicht auf euch übertragen lässt. Sprecht über Szenen wie die in Call of Duty: Modern Warfare 2, bei der ein Verweigern des Tötens von Zivilisten keine negativen Konsequenzen nach sich zieht und dementsprechend nicht forciert wird. Erzählt von dem schlechten Gewissen, dem Abwägen zwischen Moralitätsempfinden und Siegeswunsch und der Nachdenklichkeit, die besonders im Story-Modus immer mal wieder auftaucht. Diskutiert die dann auch notwendig klingende Regulierung von Büchern, Filmen und besonders den Nachrichten, in denen wir doch jeden Tag mit mehr Gewalt konfrontiert werden als in den meisten Spielen. Argumentiert wie ihr wollt, aber um Himmels Willen, argumentiert doch! Wie könnt ihr erwarten, dass Menschen, die sich mit der Materie nie umfassend beschäftigt haben, ihre Meinung ändern, wenn ihr ihnen nicht neue Informationen zur Verfügung stellt?
Um diesen Gedanken etwas humorvoll abzuschließen, hier in etwa die Worte, die ein recht selbstironischer Dozent und Psychoanalytiker zum Thema der Modellwirkung von Medien an uns richtete, um dabei die starke Vereinfachung durch Laien etwas auf die Schippe zu nehmen: „Wenn Videospiele aggressiv machen, macht Lesen dann auch aggressiv? Und wenn Models magersüchtig machen, [auf seinen Bauch guckend], warum mache ich dann nicht adipös?"


Was tun?
Angst zu haben ist verständlich, aber die Schuld bei leblosen Objekten zu suchen, wird euch nicht helfen. Wenn ihr wirklich etwas tun wollt, liebe Politiker, lieber Durchschnittsbürger von nebenan und vor allem liebe kassenärztliche Vereinigungen, dann schaut dahin, wo es brennt. Nicht jeder psychisch kranke Mensch, der Hilfe braucht, kann in Deutschland Hilfe bekommen. Ja, nicht einmal jeder psychisch kranke Mensch, der Hilfe möchte, kann Hilfe bekommen. Wochen- bis monate-, bei entsprechenden Spezialtherapien auch mal jahrelange Wartezeiten sagen einiges über die derzeitige Verfügbarkeit von professioneller Unterstützung aus.
Das Problem ist hierbei nicht etwa die Anzahl an Therapeuten, sondern dass aufgrund der Bedarfsplanung der kassenärztlichen Vereinigungen genau festgelegt ist, wie viele Psychotherapeuten von den Krankenkassen eine Zulassung bekommen. Diese Zahl ist an eine Schätzung der sich in einem Gebiet befindenden psychisch Kranken gebunden. Die bereits genannten Wartezeiten sprechen eine sehr deutliche Sprache, wie realistisch diese Schätzungen sind. Wer keine Zulassung bekommt, kann zwar therapieren, die Kosten werden dann allerdings nicht von den Krankenkassen übernommen. Und Psychotherapien sind nicht nur wenig spaßig, sondern finanziell alleine auch kaum stemmbar, wenn es sich nicht um exemplarische Einzelsitzungen handelt. Erneut: Hilfe ist nicht grenzenlos verfügbar, nicht einmal annähernd. Manchmal folgt sie erst, wenn das Kind schon längst in den Brunnen gefallen und qualvoll ertrunken ist, während wir alle hilflos dabei zugesehen haben.


Aber es fängt schon viel früher an. Warum warten, bis sich eine psychische Störung manifestiert hat? Prävention ist eins der wichtigsten Stichwörter in diesem Zusammenhang. Wir brauchen nicht nur besser ausgebildete Erzieher und Lehrer, die psychisch auffällige Kinder möglichst früh erkennen können und wieder einen größeren Erziehungs- als reinen Lehrauftrag erhalten, sondern auch viel mehr Aufklärung. Wie viele sind noch immer der Meinung, nur körperlicher und sexueller Missbrauch könne sich auf die Psyche auswirken? Die Folgen seelischer Gewalt wie Herabsetzung des Selbstwertgefühls durch Beschimpfungen, Einschränkung der Individualität und soziale Isolation durch übermäßig starke Familienbande werden weit unterschätzt, körperliche Gewalterfahrungen und Mobbing bagatellisiert. „Was dich nicht umbringt, macht dich stärker" ist eine Phrase, die längst aus unserem Wortschatz gestrichen werden hätte sollen.
Ihr habt Angst um eure Kinder, Partner, Freunde? Verständlich. Dann geht in die Offensive, geht die Diskussion ein und beschränkt euer Sichtfeld nicht auf den eingerissenen Fingernagel, wenn die Hand bereits abgetrennt wurde. Große revolutionäre Akte sind gar nicht nötig, manchmal reicht es schon, für jemanden da zu sein oder ihn zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen und auf dem manchmal qualvoll langen Weg nach dieser nicht aufzugeben. Weshalb uns die scheinbare, aber nie wirklich stattfindende Killerspiele-Diskussion nervt? Weil sie uns davon abhält, über das Wesentliche zu sprechen und hierbei wertvolle Zeit und Energien in nicht zielführende Talk-Formate, Politiker-Ansprachen und leere Phrasen gesteckt werden, durch die sich am Ende doch nichts ändern kann, weil wir nur an der Oberfläche kratzen. Amokläufe sind nicht das Problem. Sie sind das Symptom. Und solange wir das Problem nicht beheben, wird sich langfristig nichts ändern.